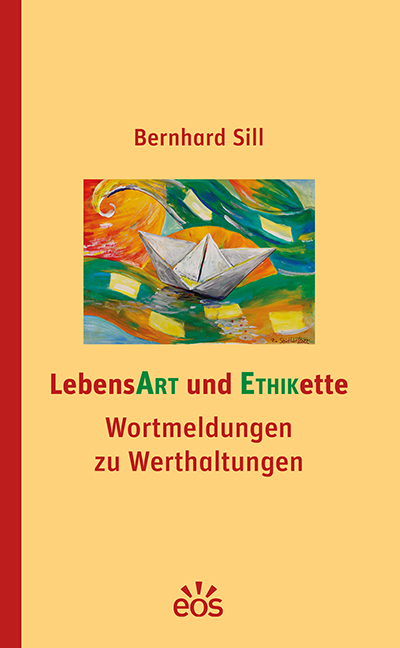 | »Bücher«, so soll der deutsche Dichter Jean Paul (1763-1825) einmal angemerkt haben, seien »nur dickere Briefe«, geschrieben in der Absicht, die Kommunikation mit denen, die man zu Freund*innen hat oder doch zu gewinnen hofft, zu pflegen. Eben das will auch dieses Buch sein: ein dickerer Brief an jetzige und künftige Freund*innen, welcher Gedankenfäden spinnt zu »LebensArt und Ethikette«. Versammelt sind im Briefbuch bzw. Buchbrief Erkundungen und Erzählungen, An- und Bemerkungen zur Kunst der Nächsten-, Gottes- und – nicht zu vergessen – Selbstliebe, zur Kunst, echte Freundschaften zu pflegen, zur »geschicht«-lichen Kunst des Erzählens, zur Kunst, das »Herz-Werk« (Rainer Maria Rilke) des Betens zu tun, weiterhin zur Kunst, »summa cum gaudi« zu lernen und zu lehren, und nicht zuletzt zur Kunst, den »Deus incognito« überall dort zu erkennen, wo er als er selbst erkannt sein will.
 |