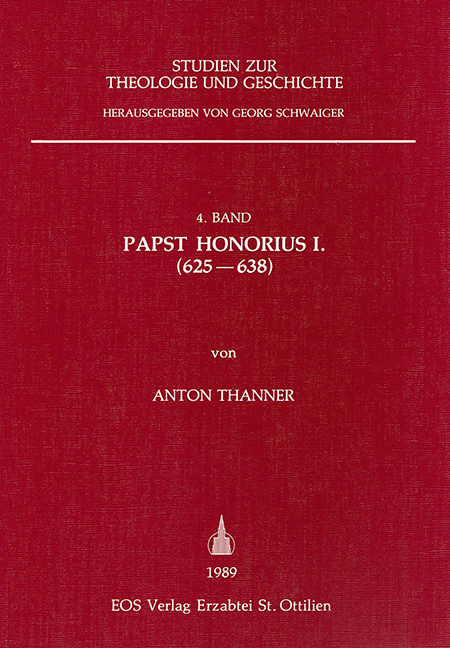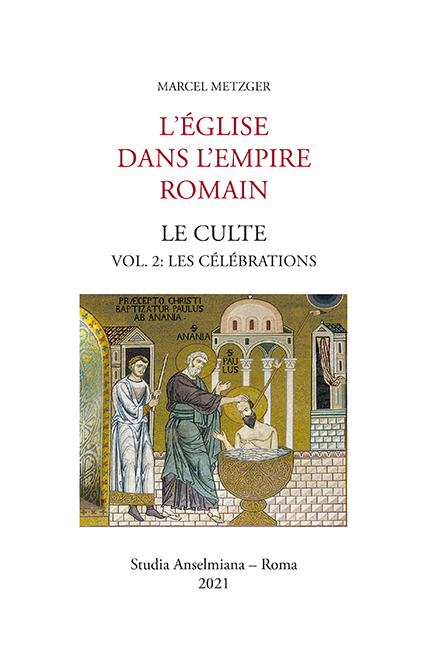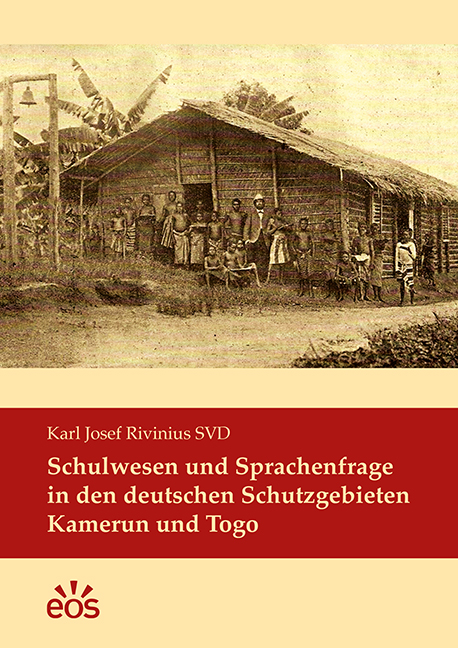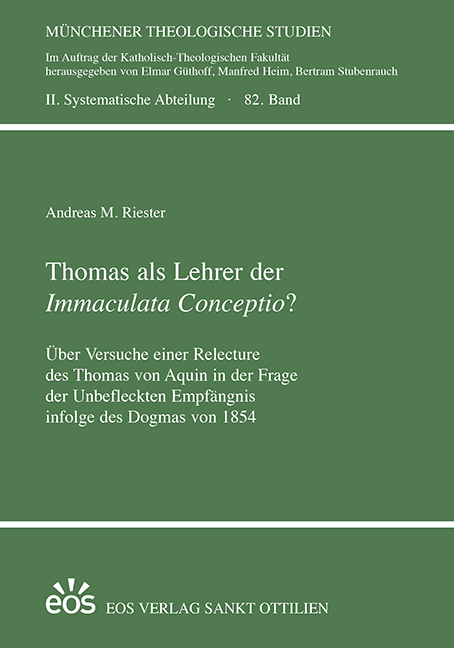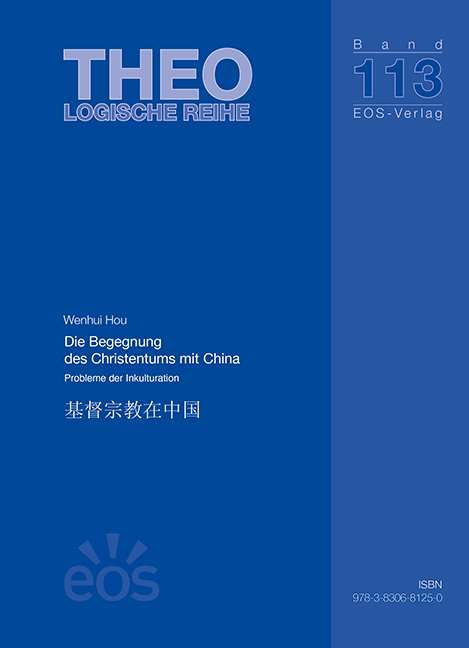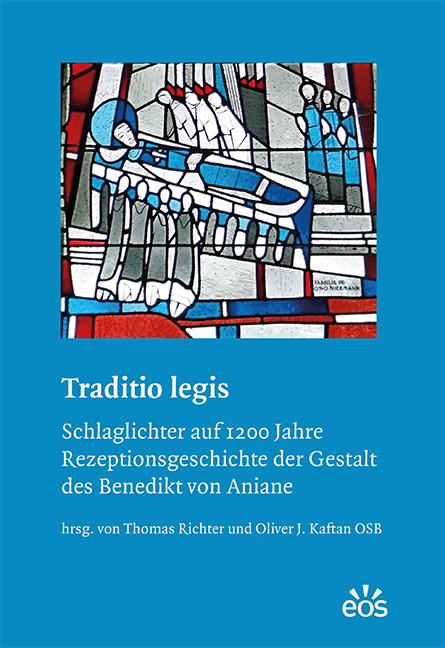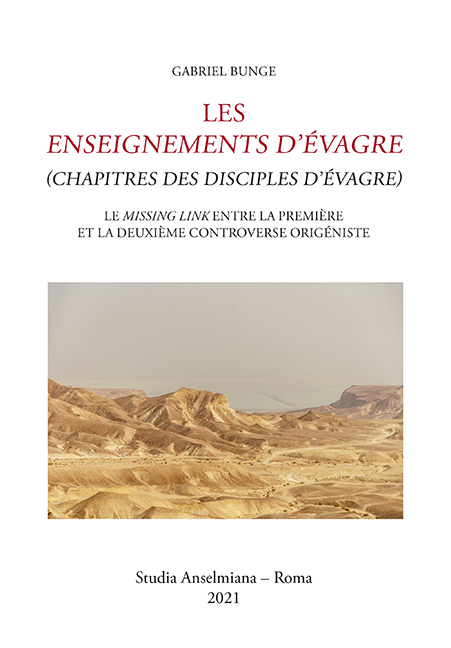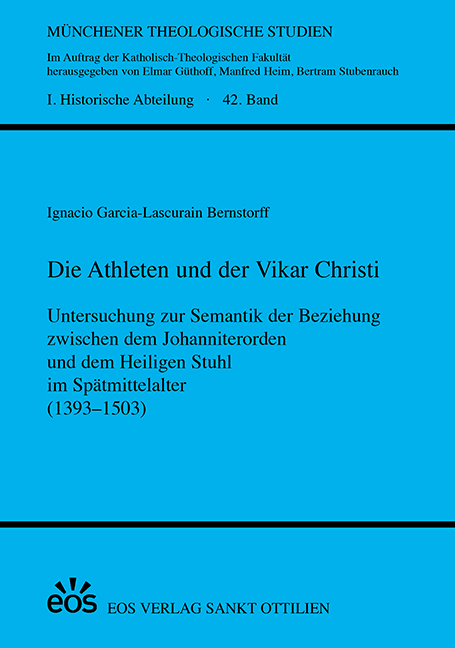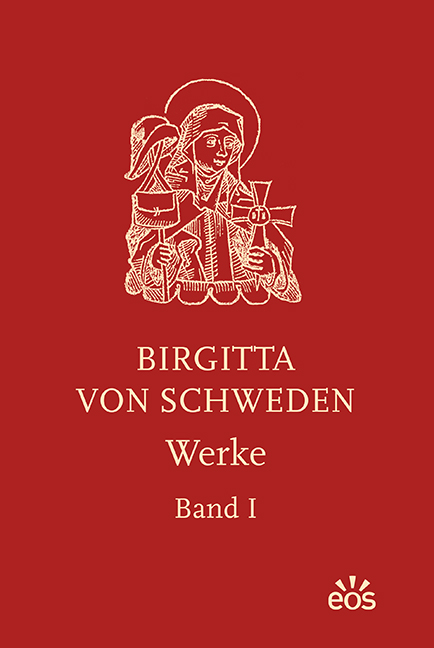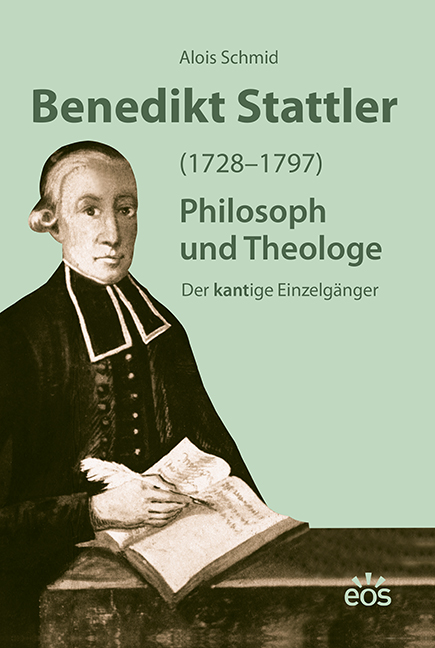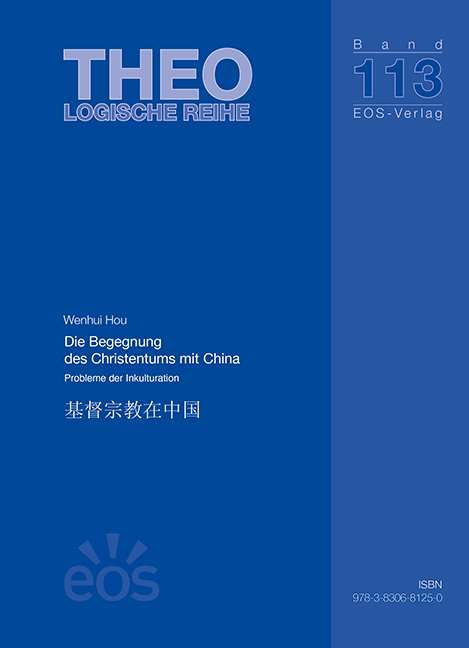 | Im Verlauf der Geschichte haben die christlichen Kirchen viermal versucht, China zu missionieren – ohne größeren Erfolg. Das vorliegende Buch sieht die Ursache für dieses Scheitern in der Unfähigkeit der Kirche, das Christentum in den Lebenskulturen Chinas zu beheimaten, d. h. den christlichen Glauben dort zu inkulturieren. Zur Begründung seiner These analysiert der Verfasser Probleme der Inkulturation des Christentums aus historischer, kultureller und theologischer Perspektive. Er nimmt dabei vor allem solche Bereiche in den Blick, in denen heute Inkulturation und Evangelisierung erfolgen kann und muss. Die Liturgie, das Gemeindeleben, die Priesterausbildung, die theologischen Wissenschaften sowie die Bereiche der Kunst sind Felder, in denen die Kirche Chinas ihre eigene, ortskirchliche Identität entwickeln kann. Für die Zukunft der Kirche in China ist lebenswichtig, dass sie die Möglichkeiten der Inkulturation nutzt und für den Glauben Formen schafft, die für die Gläubigen Chinas zur Heimat werden können.
 |